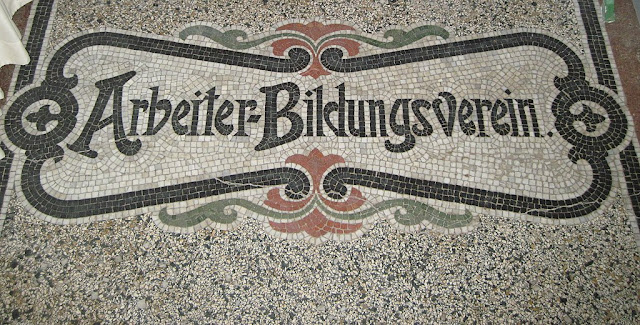Im Windschatten des Versuchs, zunehmenden Widerspruch gegen vormals meinungsprägende Positionen als Cancel Culture zu diffamieren, entsteht gerade eine, wie ich finde, gute und zielführende Debatte über Gesellschaft, Gemeinschaft, kollektive Identitäten oder identitäre Kollektive. Wolfgang Thierse in der FAZ und Gesine Schwan in der SZ sind nur zwei Beispiele, aber sie zeigen, wie sehr das Thema inzwischen in der Mitte des Diskurses angekommen ist.
Mich inspiriert diese Diskussion auch deshalb, weil meine Agentur diese Entwicklung unter dem Thema polykulturelle Ära diskutiert und daraus Kommunikationsansätze entwickelt. Für Europa treibe ich dieses Thema bei uns gerade voran und lese und denke sehr viel daran herum. Im Kern und sehr stark vergröbert geht es dabei darum, dass wir in einer Zeit leben, in der sich Identität mehr über kulturellen Ausdruck konstituiert als über Herkunft oder formale Zugehörigkeit zu einer Gruppe. Und dass jede dieser Gruppen, die sich gemeinsam kulturell ausdrücken, eine (kleine) Minderheit ist - sie aber zusammen inzwischen die Mehrheit bilden. Und das nicht mehr nur in der jüngeren Generation, in der wir dieses Phänomen schon länger beobachten.
Übertragen auf Europa und auch und speziell auf Deutschland, ist die Situation insofern etwas anders, als die nordamerikanischen Gesellschaften schon sehr viel länger, eigentlich seit rund 400 Jahren, sehr viel diverser sind. Aber das Verständnis einer polykulturellen Ära im Unterschied zu einer multikulturellen Ära davor ist auch für den alten Kontinent erhellend, denke ich. Denn multikulturell bezog sich immer eher auf die Herkunft und das kulturelle Erbe vor allem von eingewanderten Gruppen – und es war immer bezogen auf eine Leitkultur (mal von der hochproblematischen Konnotation des Begriffs selbst abgesehen) als der Kultur der sogenannten Mehrheitsgesellschaft, meist die seit mehreren Generationen indigene Mehrheit eines Landes.
Auch in Deutschland hatten wir immer wieder mehr oder weniger hilfreiche Diskussionen rund um eine Leitkultur. Die neue Diskussion, wie sie von Schwan und Thierse beispielsweise geführt wird, erkennt nun endlich an, dass es dieses Konstrukt so nicht mehr geben kann. Und zwar, weil es keine klassische Mehrheitsgesellschaft mehr gibt (wenn es sie denn je gegeben hat, aber das ist eine andere Geschichte). Mir hilft die Idee einer polykulturellen Ära sehr, um diese Veränderung zu beschreiben und damit (produktiv) umzugehen. Und sie erklärt zugleich mein Unbehagen mit den Positionen von Thierse und Schwan.
Denn trotz allem schwingt noch das Erklärungsmuster einer Mehrheit mit (bei Thierse deutlich krasser, da er seine Privilegien unreflektiert ausbreitet). Daraus befreit der Gedanke der polykulturellen Minderheiten-Mehrheit – weil er es schafft, zu benennen, was die Realität ist: dass es keine gemeinsame kulturelle Ausdrucksweise gibt, die die Mehrheit der Gesellschaft abbildet. Keine gemeinsame oder auch nur mehrheitliche Identität.
Wenn aber – durch jeweils selbstgewählte oder erworbene Zuordnung zu einer kollektiven Minderheiten-Identität – eine Gesellschaft entstanden ist, in der diverse polykulturelle Minderheiten zusammen die Mehrheit bilden, dann ist das etwas anderes als die (wie ich finde postmoderne) Idee im Grunde fraktaler Persönlichkeiten, also die Idee, dass ich mich aus verschiedenen kulturellen Entwürfen bediene, um meine je eigene Identität zu formen (ich habe den Eindruck, dass das bei Schwan immer noch gemeint ist in ihrer Vision).
Tatsächlich sehe ich, dass die postmoderne Individualität (wieder) abgelöst ist von Gruppenerfahrungen. Nur dass eben keine Mehrheitsgesellschaft dabei herauskommt, sondern eine Vielzahl von kollektiven Identitäten, die sich kulturell mehr oder weniger gemeinsam ausdrücken – was ich dann als polykulturell beschreibe. Diese polykulturelle Erfahrung, die vor allem die Generation meiner Kinder auch schon lange im Alltag macht, verändert nun sowohl die Gesellschaft als auch den gesellschaftlichen Diskurs. Bis hin zu dem Widerspruch gegen unreflektierte Privilegien und das selbstpostulierte Recht der ehemaligen Mehrheit, unwidersprochen ihre Ressentiments oder Exklusionen verbreiten zu können.
Wenn die Mehrheit in einer Gesellschaft die Erfahrung macht, dass sie zu einer Minderheit gehört, verändert dies das Gesamtgefüge der Gesellschaft. So kann ich zumindest erklären, wieso beispielsweise gendersensible Sprache oder identitätssensibles Handeln von dieser neuen polykulturellen Minderheiten-Mehrheit als Selbstverständlichkeit betrachtet und auch eingefordert werden: der eigene kulturelle Minderheitenstatus ermöglicht mir, Ausgrenzung und Marginalisierung anderer eher wahrzunehmen, als wenn ich mich zu einer Mehrheit dazugehörig fühle.
Insofern sind Menschen, die auf die Rechte oder auch nur Anerkennung einer Minderheit pochen, die für Teilhabe einer Minderheit streiten, keineswegs dafür mitverantwortlich, die "Mehrheit" mitzunehmen oder für den Zusammenhalt zu sorgen. Denn sie erfahren ja, dass eine Teilhabe von Minderheiten und eine (kulturelle) Sensibilität für Minderheiten de facto Teilhabe und Sensibilität für die Mehrheit bedeutet.
Und insofern kann das Getöse über eine angebliche Cancel Culture oder über den angeblichen Zwang zur Sensibilität eigentlich nur auf zwei Weisen beschrieben werden: Entweder als "Rückzugsgefecht" einer Minderheit, die noch nicht anerkennen kann, dass sie inzwischen eben dieses ist, eine Minderheit, obwohl sie noch eine Generation vorher die Mehrheit war. Oder als reaktionäres (oder revolutionäres) Projekt, das einer Minderheit die Vorherrschaft über andere Minderheiten sichern (oder verschaffen) will.
Für die Gesellschaft aber ist die neue Zeit einer polykulturellen Minderheiten-Mehrheit ein Gewinn, denke ich. Denn sie wird nahezu zwangsläufig offener und auch sensibler (beides halte ich für einen Gewinn, aber darüber lässt sich wahrscheinlich politisch streiten). Und kollektive Identitäten spielen dabei in meiner Sicht (und anders als Schwan und wahrscheinlich auch Thierse es sehen) eine entscheidende und positive Rolle: Durch die Erfahrungen des Minderheitenstatus, die ich in meinem Kollektiv mache, in meiner Gemeinschaft, öffnet sich der gedankliche Möglichkeitenraum für Minderheitenrechte, für Sensibilität, für die Offenheit für andere kulturelle Ausdrucksformen.
Der politische Liberalismus hat historisch immer Gesellschaft der Gemeinschaft vorgezogen, während konservative und revolutionäre Ansätze oft von der Gemeinschaft als sinnstiftender Einheit her kommen. Insofern mag es auch kein Zufall sein, dass der politische Kampf um die offene, liberale Gesellschaft an dieser Linie verläuft. Und die polykulturelle Minderheiten-Mehrheit es ist, die die liberale Demokratie gegen ihre Feind:innen verteidigt – während es die Minderheit, die sich mit ihrem (neuen) Minderheitenstatus nicht abfinden kann, mit Begriffen wie Leitkultur oder mit einem Festhalten an hergebrachten Regeln und Sprachen und Sprechweisen de facto auf die liberale Demokratie abgesehen hat.
Ich kann die Sorge, eine Gesellschaft falle auseinander, wenn sie sich in polykulturelle Minderheiten und kollektive Identitäten auffächert, nicht nachvollziehen. Mein Eindruck ist, dass Schwan und Thierse und andere genau diese Sorge haben. Sie wäre berechtigt, wenn es eine Mehrheit gäbe – was ja die gesellschaftliche Situation ist, aus der beide kommen, sie sind ja beide noch mal massiv älter als ich. Und tatsächlich drohte ja bis vor etwa zehn Jahren oder so ein Auseinanderdriften der Gesellschaft im Zuge der identiätspolitischen Ansätze. Aber heute, wo beispielsweise in den USA die identitätspolitische Koalition der Demokrat:innen eine strukturelle Mehrheit hat, und wo auch beispielsweise in Deutschland identitätspolitisch motivierte Koalitionen wie die Grünen und (mit Ausnahme einiger Traditionssozialdemokrat:innen) SPD Zulauf bekommen und selbst die CDU mindestens in Teilen eine identitätspolitische Koalition ist; heute also zeigt sich, dass eine Gesellschaft, in der es eine polykulturelle Minderheiten-Mehrheit gibt, eine Chance hat, als offene liberale Demokratie einen weiteren Schritt auf eine inklusive, sensible Gesellschaft hin zu machen. In dem kollektive Identitäten, die um ihren Minderheitenstatus wissen, gemeinsam Teilhabe und sensiblen Umgang miteinander schaffen.
[Edit 21.40 Uhr: Mir war, als ich diesen Text online stellte, noch nicht klar, welche Wellen bis hin zum leberwurstigen Austrittsangebot Thierses (es lohnt sich hier auch auf die Verlinkungen zu klicken, um das ganze Ausmaß zu sehen) diese Diskussion in der SPD schlägt. Gut.]