Ob es wirklich Mut ist, weiß ich nicht. Vielleicht ist es auch einfach nur Zutrauen. Oder die Sehnsucht.
Damals vor 21 Jahren, als wir, beide noch im Studium, heirateten, fanden das viele mutig. Zumal die, die wussten, dass dieses ein Schritt war, der für uns nur eine Richtung kannte. Wir kommen beide aus einem religiösen Zusammenhang, in dem es so etwas wie Scheidung nicht gibt. In dem so etwas wie eine Ehe ein Leben lang gilt. In dem so etwas sehr endgültig für diese Welt ist. Wo Zutrauen in die Zukunft und ein sich völlig Einlassen nicht nur so daher gesagt ist.
Damals vor 19 Jahren, als wir, beide am Ende der Studiums, am Schritt in die Berufsausbildung, ein Kind wollten und provozierten, fanden das viele mutig. Weil wir zwar irgendwie auf eigenen Füßen standen, aber noch keinen Beruf hatten und nur so ungefähr wussten, was das Leben für uns bereithalten könnte. Andererseits: wer weiß das schon wann. Und wann besser als wir damals.
Das Zutrauen hat uns dann dahin gebracht, ins Leben zu gehen und das Leben zu leben.
Mut zu leben.
Damals vor knapp 18 Jahren, als ich die ersten Schritte aus dem Volontariat in die Redaktion machte und wir fanden, dass Paar mit Kind eher nicht unsere Perspektive sein sollte sondern Familie, fanden das viele mutig. Vor allem die ohne Kinder. Aber wir hatten das Zutrauen. Zumal Primus, wie ein Freund damals sagte, der nie Kinder wollte und nie welche bekam, irgendwie auch eine Werbeveranstaltung für Kinder war, so friedlich und Mut machend auf Kinder. Und dann kam es ein bisschen anders, weil Secundus so anders war. Aber es ging, wir waren jung, wir waren müde, wir hatten ein Leben als Familie vor uns, wir machten uns auf den Weg.
Damals vor 15 Jahren, als wir beide wieder beruflich Fuß fassten, die Kinder durch den Hammer Park schoben und ein halbes Haus am Stadtrand planten, fanden uns viele mutig. Vor allem die, die der Meinung waren, eine Immobilie würde immobil machen und sei für ein ganzes Leben.
Zutrauen hat uns dahin gebracht, diesen Schritt zu gehen. Und der gemeinsame Weg mit unser engsten Freundschaftsfamilie, die mit uns gleichzeitig schon Kind und Familie begonnen hatte. Und nun auch ein Haus baute, wenn auch nicht in unserer Nähe.
Vielleicht war es dieses Zutrauen, das wir in einander hatten. Und das Beispiel, das wir uns gegenseitig gaben. Dass es gehen kann. Dass es nicht absurd ist. Dass wir es nicht einmal als mutig empfanden. Und es uns doch Mut machte.
Mehr Sehnsucht als Mut waren die Schritte zu Tertius und Quarta. Zu neuen Häusern, mal gemietet, mal finanziert. Wir hatten Zutrauen zum Leben gefasst und wussten, dass wir uns auf einander verlassen konnten. Und haben, das wissen wir heute, das war uns damals nicht so bewusst, anderen Mut gemacht. Das waren immer die schönsten Komplimente, die ich bekommen durfte: wenn jemand sagte, unser Leben habe ihr Mut gemacht. Zum eigenen Kind, zur Beziehung, zum Leben.
Neulich sagten wir zu Freunden, deren ältestes Kind in die Pubertät kommt, dass es lohne, sich daran zu gewöhnen, weil es so für mindestens zehn Jahre bleibe. Sie lachten es weg, weil sie sahen, dass wir immer noch leben. Mit drei Jungs in der Pubertät.
Vielleicht ist es mutig, der Sehnsucht und dem eigenen Zutrauen nachzugeben. Aber der Lohn ist ein Leben, das sich nicht so anfühlt, als würde ich etwas verpassen. Und das nicht wartet.
Mir übrigens machen meine Großeltern Mut, die beide dieses Jahr 89 werden und seit mehr als 68 Jahren jede Nacht Hand in Hand einschlafen.
____
Teil der #mutmachparade vom mutmachenden Johannes Korten, den ich so sehr schätze für alles, was er macht und schreibt und erzählt.
23.5.14
18.5.14
Typisch für Doitschland. Oder auch: mimimimi
Dies ist ein Rant oder soll einer werden. Das vielleicht vorne weg, damit es niemand übersieht, weil es nur in den Stichworten steht. Und ich werde keinen der vielen Artikel und Posts verlinken, über und gegen die ich hier rante, denn ich bin zu faul und zu deutsch, um sie jetzt wieder rauszusuchen. So Leute wie Christian Jakubetz oder Henning Groß oder Martin Weigert werden es auch so merken oder auch nicht, ist mir eigentlich auch egal. Denn bei einem Rant geht es, wie ihr wisst, um mich. Und nicht um euch. Ha. Und für die, die lieber was nettes und positives lesen wollen, setze ich unten noch mal ein paar Links auf positive Posts. :)
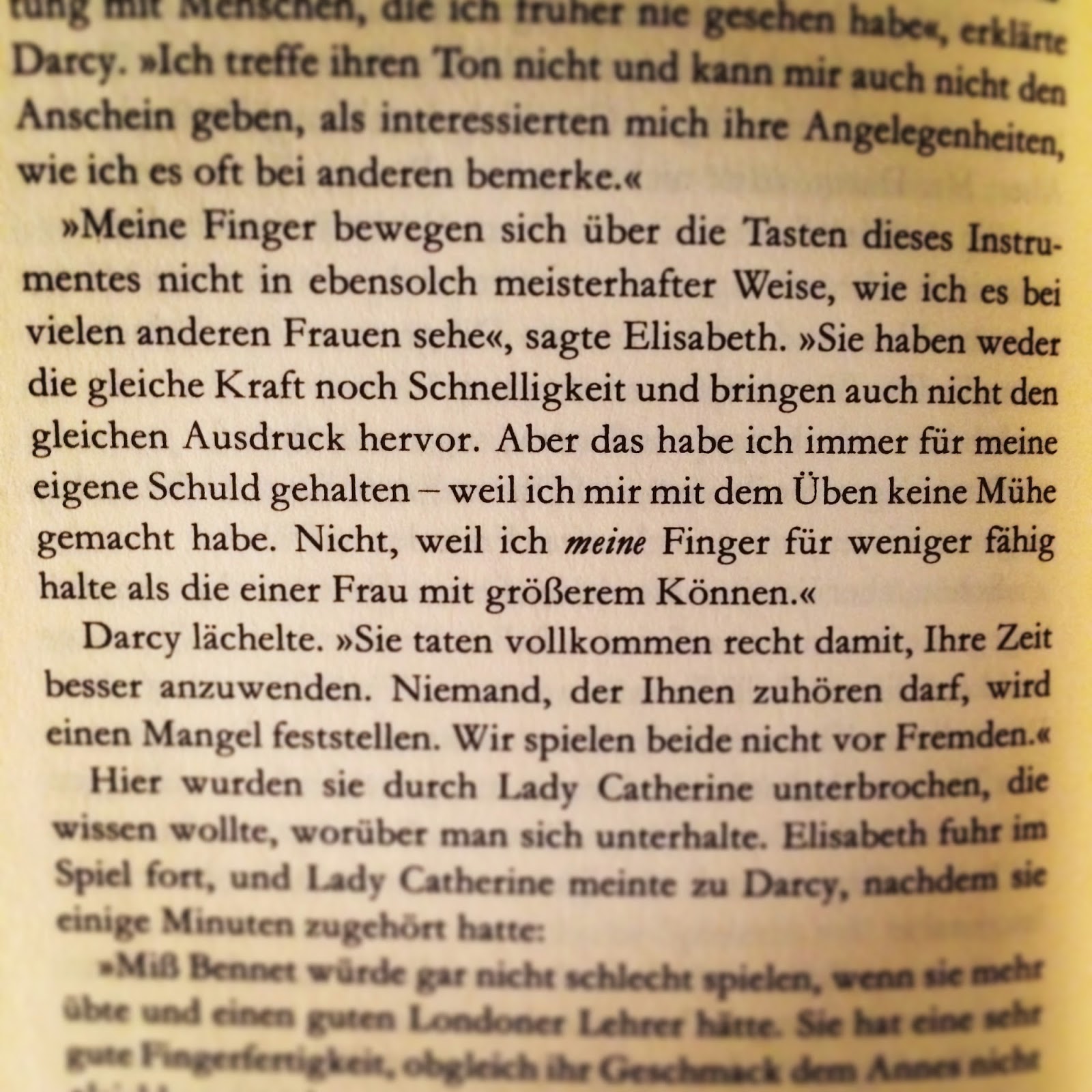 |
| Stolz und Vorurteil, 31. Kapitel |
Jedenfalls musste ich das gesamte Wochenende, wenn ich nicht gerade auf der Rennbahn, genauer: an der Ovalbahn stand und meinen Kindern beim Sport zuguckte und mich um ihre Pferde kümmerte, an jene wunderbare Passage im 31. Kapitel von Stolz und Vorurteil denken, kurz bevor der Scheitelpunkt der Geschichte naht. Und überhaupt, dachte ich mal wieder, rede ich nicht gerne mit Leuten, die noch nie was von Austen gelesen haben. Wenigstens dieses größtartigste Buch von ihr. Naja.
Und dann fragte ich mich mal wieder, wieso eigentlich so viele Leute aus meiner Ecke des Internets so enorm in ihrer nationalen Filterblase gefangen sind (plus, das muss ich zugeben, dem winzigen Teil der internationalen Szene, die da, in dieser Blase, reflektiert wird). So dass in mir der Beschluss reifte, einfach mal gegen Gassner's Law (googelt das, hab ich keine Lust, zu erklären. Wer es nicht versteht, ach auch egal) zu verstoßen und wild hinauszurufen, was mich so ankotzt an diesem Mimimi der Leute rund um Leute, die was gründen oder einen Gruenderus interruptus vorbereiten. Naja.
Gestern dachte ich noch daran, dass ich seit Jahren keinen Vortrag eines Amerikaners oder einer Amerikanerin mehr gehört habe, in dem nicht bei den Beispielen oder Kronzeuginnen mindestens die Hälfte Frauen waren. Aktuell am Donnerstag wieder der von Rei Inamoto auf dem ADC-Kongress. Ganz selbstverständlich übrigens und ohne dass es einer Rede wert wäre. Dass ich es hier aufschreibe, ist eigentlich schon wieder so ein Ding mit Doitschland. Naja.
Ich finde es so sauschade, dass es sich Gründerinnen und Gründer in Doitschland so schwer machen, dass sie es so schwer haben. Und ganz un-rant-ig sehe ich dafür auch Gründe. Drei. Mit denen sich unsere Szene wirklich unterscheidet von allem, was ich in zivilisierten Ländern, also ohne Frankreich, erlebt habe. Zum einen, dass sie so erstaunlich wenig marktorientiert ist. Zum anderen, dass sie so dumpf national vor sich hin dümpelt und abgekoppelt ist von den weltweiten oder anderswo stattfindenden Diskursen. Und zum dritten, dass sie geschlagen ist mit einem so trist-traurigen Fanboytum, dass es einen schüttelt.
Aber erstmal weiter ranten. Ich mein, wenn ein Don Alphonso in seiner besten Zeit, die nun auch schon mehr als acht Jahre zurück liegt, selbst damals also nur ein trist-trauriger Abklatsch eines Loren Feldman war. Wenn es hier allen Ernstes Leute gibt, die Kritik, wie sie hier geübt wird, nicht etwa darum für im internationalen Vergleich doof finden, weil sie so zahm und konstruktiv ist, sondern die offenbar nicht mal wissen, wie krass beispielsweise in den USA solche Diskussionen laufen. Wenn ich die Leute mit der Lupe suchen muss, die sich an das so genannte Kathy Sierra Incident erinnern und wissen, wie radikal das damals die Szene der Webpublizisten und der Techblogs verändert hat. Naja.
Das macht echt keinen Spaß. Denn ich bin mir sicher, dass die struntzdumme Fanboycrowd der wichtigste Grund ist, warum sich die Achtsamkeitskultur in der Web- und Gründungsszene in Doitschland so weit vom internationalen Standard abgekoppelt hat, dass es schmerzt. Und in den letzten fünf, sechs Jahren hat es sich bewährt, eine kurze Frage nach dem Kathy Sierra Incident als Lakmustest für die Satisfaktionsfähigkeit eines Diskursgegenübers zu nehmen.
Ich kenne selbst auch nur Skandinavien und die USA genauer. Aber dass da mit viel Pomp ein Projekt aus der Taufe gehoben würde, das fast ausschließlich aus Leuten besteht, die sich bereits kennen. Und dass das dann von deren Freundinnen per Akklamation der Diskussion entzogen würde. Das ist schlicht undenkbar und ein super trauriger doitscher Sonderweg. Der, da bin ich sicher, sehr viel mit dem großartigen, stilbildenden, weltweiten Erfolg deutscher Startups zu tun hat. Naja.
Sich mit Menschen zu umgeben, die einem widersprechen, ist nicht so typisch in Doitschland. Und das ist - um es einmal sehr zurückhaltend zu formulieren - echt kakke. Und führt eben zu dem gleichen Phänomen, dessentwillen auch Petzen und Denunziantentum so typisch doitsch ist. Denn in allen zivilisierten Ländern sind die, die hier so beschimpft werden, Heldinnen. Die Angst vor Kritik, die geradezu religiöse Verehrung derVorturnerinnen Vorturner der eigenen Filterdings, die Beschimpfung derer, die Fragen stellen - all das ist ein doitscher Irrweg. Und der wird nur noch getoppt von der Weigerung seiner Protagonistinnen, die normalen und gesunden Diskurskulturen in gründungsfreundlichen Ländern zu sehen und anzuerkennen. Die viel mit Kritik, mit sehr früher Kritik vor allem zu tun haben - und über die Jahre dazu führten, dass eben nicht nur gleiche vom gleichen sich zusammen tun, nicht nur Sebastians oder Stefans Freunde, sondern Fremde. Spannende Menschen, die einander über zwei Ecken kennen. Und sich als allererstes einmal sehr genau das Marktpotenzial angucken. Und wen sie gewinnen wollen. Und darum ansprechen. Auch übers Team, auch über den Namen, auch über die Kultur.
Und hier alle nur so Mimimi.
Update 20.5.
Und weil mich erschreckt, wie Claudia Klinger das Netz wahrnimmt, hier noch fünf Links auf Posts, in denen ich positiv auf das Leben und das Netz und so zugehe:
Richtiges Leben
Hausgeburten und Krankenhäuser
Kontinuität und Widerstand
Geht alles doch
Demut
Sich mit Menschen zu umgeben, die einem widersprechen, ist nicht so typisch in Doitschland. Und das ist - um es einmal sehr zurückhaltend zu formulieren - echt kakke. Und führt eben zu dem gleichen Phänomen, dessentwillen auch Petzen und Denunziantentum so typisch doitsch ist. Denn in allen zivilisierten Ländern sind die, die hier so beschimpft werden, Heldinnen. Die Angst vor Kritik, die geradezu religiöse Verehrung der
Und hier alle nur so Mimimi.
Update 20.5.
Und weil mich erschreckt, wie Claudia Klinger das Netz wahrnimmt, hier noch fünf Links auf Posts, in denen ich positiv auf das Leben und das Netz und so zugehe:
Richtiges Leben
Hausgeburten und Krankenhäuser
Kontinuität und Widerstand
Geht alles doch
Demut
13.5.14
Einfach mal die Klappe halten
Ich lache jedes Mal laut, wenn jemand mit dieser wunderbaren Ausrede kommt, es gäbe keine Frauen, die mitmachen wollten. Oder es hätten keine Zeit gehabt. Oder keine gewollt. Oder sich keine gemeldet. Oder so.
Ach ja, doo. Das gleiche Argument, von der Struktur her, höre ich auch, wenn in meiner Partei, den Grünen, Männer (und teilweise auch Frauen) sich "beschweren", eine quotierte Liste hindere Männer an etwas, weil nicht genug Frauen mitmachen.
Meine Tipps dazu:
Wo ist denn die geheime Insel, auf der die ganzen Frauen, die immer angefragt werden und keine Zeit haben, an der Weltherrschaft arbeiten?
— habicht (@habichthorn) May 13, 2014
Ach ja, doo. Das gleiche Argument, von der Struktur her, höre ich auch, wenn in meiner Partei, den Grünen, Männer (und teilweise auch Frauen) sich "beschweren", eine quotierte Liste hindere Männer an etwas, weil nicht genug Frauen mitmachen.
Meine Tipps dazu:
- Einfach mal die Klappe halten und sich nicht so wichtig nehmen.
- Einfach mal darüber nachdenken, ob es sein könnte, dass so wenige Frauen mitmachen wollen, weil es einfach doof ist, was ich vorhabe.
- Einfach mal absagen, wenn es nicht möglich ist, etwas mit mehr Verschiedenheit zu besetzen.
- Einfach mal anstrengen, wenn es dir wirklich wichtig ist, das Thema. Denn wenn es auch anderen so geht, werden sich auch andere finden. Sonst 2. oder 3. versuchen.
- Einfach mal die Klappe halten und sich nicht so wichtig nehmen. Bist du nicht.
In den letzten fünfundzwanzig Jahren, in denen ich halbwegs sensibilisiert für Verschiedenheiten und vor allem für feministische Fragestellungen unterwegs war, hat sich als über-den-Daumen-Realität herausgestellt, dass Dinge, für die sich kaum Frauen finden ließen, um mitzumachen, mitzudiskutieren etc auch echt doof waren. Und dass die Jungs es besser gelassen hätten. Denn die Bereitschaft von Frauen, sich zu engagieren und zu beteiligen, ist ein ziemlich guter Indikator für Undoofheit, so ist meine Erfahrung. Und die drei Fälle, in denen dieser Indikator falsch lag, sind dann ein verschmerzbarer Kollateralschaden.
Nein, ich rede weder explizit über den Krautreporter noch über die falschrum teilquotierten Listen der Grünen in Wandsbek und Rahlstedt für die Bezirksversammlungswahl.
Aber irgendwie auch.
Nein, ich rede weder explizit über den Krautreporter noch über die falschrum teilquotierten Listen der Grünen in Wandsbek und Rahlstedt für die Bezirksversammlungswahl.
| Symbolbild. Bild: By Elvis untot (Own work) CC-BY-SA-3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) |
Aber irgendwie auch.
10.5.14
Aufbruch zum Denken
Dass ich nicht so der re:publica-Gänger war, lag nicht an der re:publica. Im Gegenteil: als sie damit anfingen, die auf die Beine zu stellen, kannte ich ja die Leute, die die re:publica machten, schon lange, sie stammen, wie es die Kaltmamsell immer so nett formuliert, "aus der gleichen Ecke des Internets" wie ich, aus dieser Altbloggerdingens. Es war nur so, dass es terminlich nie passte, vor allem, wenn es in den Schulferien lag (die in Hamburg ein bisschen antizyklisch sind im Frühjahr). Und dann hab ich das eine oder andere Mal die jungen Leute hingeschickt und im Büro die Stellung gehalten.
Was mir beim Stöbern durch die Konserven nie so komplett klar wurde und was ich auch von denen, die da waren, nie so klar gespiegelt bekam, war etwas, das mich dieses Jahr, auch wenn ich nur einen Tag vor Ort sein konnte, unglaublich fasziniert und begeistert hat: Dass die re:publica keine Internetkonferenz ist sondern tatsächlich ganz anders, also so richtig ganz anders als eine solche. Dass sie denen, die sich darauf einlassen mögen, einen Anlass zum Denken bietet. Und dass sie ein Aufbruch zum Denken ist.
(Zur Lobo-Rede hatte ich mich ja bereits zustimmend geäußert übrigens.)
Laurie Penny habe ich auch schon sehr gerne und mit großem persönlichen Gewinn gelesen, vielleicht ist sie wirklich die wichtigste Feministin der nächsten Generation (dringende Leseempfehlung ist ihr Aufsatzbändchen Fleischmarkt). Auf sie war ich besonders gespannt und froh, sie einmal live zu erleben. Und Teresa Bücker ist, ja, ich weiß, da bin ich nicht der einzige, der das sagt, vielleicht der Geheimtipp dieser re:publica überhaupt gewesen. Und ihre Aufregung schadet ihrem Vortrag in keiner Weise.
Zusammen 90 Minuten, die sich mehr als lohnen. Und die für einen Aufbruch zum Denken stehen, wie ihn zurzeit wirklich nur die re:publica schaffen kann.
Was mir beim Stöbern durch die Konserven nie so komplett klar wurde und was ich auch von denen, die da waren, nie so klar gespiegelt bekam, war etwas, das mich dieses Jahr, auch wenn ich nur einen Tag vor Ort sein konnte, unglaublich fasziniert und begeistert hat: Dass die re:publica keine Internetkonferenz ist sondern tatsächlich ganz anders, also so richtig ganz anders als eine solche. Dass sie denen, die sich darauf einlassen mögen, einen Anlass zum Denken bietet. Und dass sie ein Aufbruch zum Denken ist.
(Vielleicht bin ich zurzeit auch nur so besonders empfänglich für die, die an den gleichen Fragen denken wie ich. Die sich mit der Frage der Radikalität und der Re-radikalisierung auseinandersetzen - und der Frage, ob sie jetzt nötig und hilfreich ist, bis hin zum echten und nicht an sich mehrheitsfähigen Widerstand. Ich selbst raune ja das eine oder andere in dieser Richtung seit einiger Zeit in mein Blog, auch, weil ich mich nicht traue, die eigentliche Konsequenz wirklich auszusprechen. Vielleicht ist das Blog auch nicht der Ort dafür, sondern eher ein Buch, ein Pamphlet oder ein Vortrag. Das aber nur am Rande.)Und auch, wenn ich noch längst nicht alle Themen nachgehört und nachgesehen habe, die mich ansprechen und anzuregen versprechen, finde ich es nahezu beglückend, dass zwei der besonderen und besonders anregenden Vorträge von jungen Frauen stammten, die zeigen, dass es eben über die Generationen hinweg eine Kontinuität (da ist es wieder) widerständigen Denkens geben kann.
(Zur Lobo-Rede hatte ich mich ja bereits zustimmend geäußert übrigens.)
Laurie Penny habe ich auch schon sehr gerne und mit großem persönlichen Gewinn gelesen, vielleicht ist sie wirklich die wichtigste Feministin der nächsten Generation (dringende Leseempfehlung ist ihr Aufsatzbändchen Fleischmarkt). Auf sie war ich besonders gespannt und froh, sie einmal live zu erleben. Und Teresa Bücker ist, ja, ich weiß, da bin ich nicht der einzige, der das sagt, vielleicht der Geheimtipp dieser re:publica überhaupt gewesen. Und ihre Aufregung schadet ihrem Vortrag in keiner Weise.
Zusammen 90 Minuten, die sich mehr als lohnen. Und die für einen Aufbruch zum Denken stehen, wie ihn zurzeit wirklich nur die re:publica schaffen kann.
7.5.14
Kontinuität und Widerstand
Ich interessiere mich schon lange mehr für die Kontinuitäten als für die vermeintlichen Brüche in der Geschichte. Gerade die (biografischen) Linien über Umbrüche hinweg sind mir spannende Forschungsfelder gewesen. Als ich 1991 bei Werner Durth eine unglaublich dichte und inspirierende Sommerakademie zu Städtbau besuchte, habe ich erstmals einen Historiker kennen gelernt, der dieses methodisch so machte. Sein Buch Deutsche Architekten (Leseempfehlung!) habe ich verschlungen und mehrfach gelesen.
Kontinuität
Ähnlich ging mir das mit dem für mich inspirierendsten Buch der letzten Monate: Writing on the Wall von Tom Standage. Kernthese des Buchs, der ich zustimme übrigens: Social Media ist uralt und die "Normalform" von Mediennutzung über die letzten zwei Jahrtausende gewesen - von der zeitlich fast zu vernachlässigenden kleinen Unterbrechung der letzten 150 Jahre seit der Gründung der ersten Massenzeitung 1843 einmal abgesehen, in der das "Broadcast-Modell" kurz einmal vorherrschte.
Was ich so unglaublich erleichternd und erhellend an Standages Buch finde, ist eben dieser Blick in größeren Zusammenhängen und Linien auf ein Phänomen, das Teilen meiner Generation immer noch Angst macht. Und auf die Komik, mit der sich bei jeder (medientechnischen) Weiterentwicklung die selben Argumente wiederholen. So wie Plato schon gegen Schriften wetterte, weil sie das Denken und Argumentieren schädigten. So wie Erasmus gegen die Druckerpresse wetterte, weil es die Leute dazu verleite, zeitgenössische Schriften und nicht die Klassiker zu lesen. So wie im 17. Jahrhundert gegen die Kaffeehäuser gewettert wurde (aus denen die meisten Erfindungen, Erkenntnisse inklusive Newtons Durchbruch, und bis heute wichtigen Firmen wie die Londoner Börse oder Lloyd's of London stammen), weil die die Studenten und Kaufleute zu Müßigang und mangelnde Produktivität verführten und so weiter. Kennt ihr ja alle, die Argumente.
Und so, wie die historischen Linien in der größeren Sicht spannender werden und Menschen, die sich auch nur rudimentär mit Geschichte und Geistergeschichte beschäftigt haben, angesichts vieler "Diskussionen" heute nur resigniert mit den Achseln zucken lassen, so ist auch der Blick auf Analysen und Begründungen von Widerstand interessant, die es vorher einmal gab.
Widerstand
Darum ist - für mich tatsächlich überraschend, auch wenn ich ihm inhaltlich ja fast immer zustimme, schließlich sind wir eigentlich geklonte Geschwister (sagt man das so?) - Sascha Lobos diesjährige re:publica-Rede der zweite Inspirationspunkt dieses Monats. Zumal er sich an einer entscheidenden, wenn nicht der entscheidenden, Stelle auf den aus meiner Sicht größten Gesellschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts bezieht: Herbert Marcuse. Ich bin mir, auch nachdem ich mit ihm kurz darüber sprach, nicht zu 100% sicher, ob er sich wirklich der disruptiven Kraft bewusst ist, die sein Verweis auf Marcuse in der Diskussion bedeuten kann.
 Aber es ist wohl kein Zufall, dass Secundus, noch 16 Jahre alt, sich Marcuses aus meiner Sicht wichtigstes Buch Der eindimensionale Mensch (Lesebefehl! Echt jetzt!) am letzten Wochenende aus meinem Bücherschrank nahm und begonnen hat, es mit Genuss zu lesen. Er trägt ja auch eine ähnliche Frisur wie der Herr Lobo, wenn auch aus anderen Gründen.
Aber es ist wohl kein Zufall, dass Secundus, noch 16 Jahre alt, sich Marcuses aus meiner Sicht wichtigstes Buch Der eindimensionale Mensch (Lesebefehl! Echt jetzt!) am letzten Wochenende aus meinem Bücherschrank nahm und begonnen hat, es mit Genuss zu lesen. Er trägt ja auch eine ähnliche Frisur wie der Herr Lobo, wenn auch aus anderen Gründen.
Marcuse war schon in der Generation meiner Eltern einer der wichtigsten Denker und Argumentierer des Widerstandes. Und ein brillanter Analytiker von Gewalt (die nach seiner Definition immer nur aus einer Machtposition heraus ausgeübt werden kann, weil das, was andere Gewalt nennen oder Terror, wenn er nicht aus der Führungsmacht der Elite heraus kommt, eben keine Gewalt sei sondern Widerstand) und der Macht in den Strukturen und Technologien. Was ja auch der Punkt ist, den Sascha anspricht und von ihm aufgreift.
Manchmal wünsche ich mir, dass die Diskussion über die Sicherheitsesoteriker und Kontrollfanatiker mit mehr historischen Kenntnissen geführt würde. Eine Lektüre von Standages Buch (kommt wohl dieses Jahr noch auf deutsch raus) und das Ansehen von Lobos Rede kann dazu der erste Schritt sein. Und wer richtige Lektüre ertragen und verstehen kann, sollte dringend Marcuse lesen.
Und dann reden wir weiter, ok?
Update 8.5.:
In dem Sinne: Weitermachen
(Hinweis auf das Bild fand ich bei André Vatter, der es anders sieht als ich)
Kontinuität
Ähnlich ging mir das mit dem für mich inspirierendsten Buch der letzten Monate: Writing on the Wall von Tom Standage. Kernthese des Buchs, der ich zustimme übrigens: Social Media ist uralt und die "Normalform" von Mediennutzung über die letzten zwei Jahrtausende gewesen - von der zeitlich fast zu vernachlässigenden kleinen Unterbrechung der letzten 150 Jahre seit der Gründung der ersten Massenzeitung 1843 einmal abgesehen, in der das "Broadcast-Modell" kurz einmal vorherrschte.
Was ich so unglaublich erleichternd und erhellend an Standages Buch finde, ist eben dieser Blick in größeren Zusammenhängen und Linien auf ein Phänomen, das Teilen meiner Generation immer noch Angst macht. Und auf die Komik, mit der sich bei jeder (medientechnischen) Weiterentwicklung die selben Argumente wiederholen. So wie Plato schon gegen Schriften wetterte, weil sie das Denken und Argumentieren schädigten. So wie Erasmus gegen die Druckerpresse wetterte, weil es die Leute dazu verleite, zeitgenössische Schriften und nicht die Klassiker zu lesen. So wie im 17. Jahrhundert gegen die Kaffeehäuser gewettert wurde (aus denen die meisten Erfindungen, Erkenntnisse inklusive Newtons Durchbruch, und bis heute wichtigen Firmen wie die Londoner Börse oder Lloyd's of London stammen), weil die die Studenten und Kaufleute zu Müßigang und mangelnde Produktivität verführten und so weiter. Kennt ihr ja alle, die Argumente.
Und so, wie die historischen Linien in der größeren Sicht spannender werden und Menschen, die sich auch nur rudimentär mit Geschichte und Geistergeschichte beschäftigt haben, angesichts vieler "Diskussionen" heute nur resigniert mit den Achseln zucken lassen, so ist auch der Blick auf Analysen und Begründungen von Widerstand interessant, die es vorher einmal gab.
Widerstand
Darum ist - für mich tatsächlich überraschend, auch wenn ich ihm inhaltlich ja fast immer zustimme, schließlich sind wir eigentlich geklonte Geschwister (sagt man das so?) - Sascha Lobos diesjährige re:publica-Rede der zweite Inspirationspunkt dieses Monats. Zumal er sich an einer entscheidenden, wenn nicht der entscheidenden, Stelle auf den aus meiner Sicht größten Gesellschaftsphilosophen des 20. Jahrhunderts bezieht: Herbert Marcuse. Ich bin mir, auch nachdem ich mit ihm kurz darüber sprach, nicht zu 100% sicher, ob er sich wirklich der disruptiven Kraft bewusst ist, die sein Verweis auf Marcuse in der Diskussion bedeuten kann.
 Aber es ist wohl kein Zufall, dass Secundus, noch 16 Jahre alt, sich Marcuses aus meiner Sicht wichtigstes Buch Der eindimensionale Mensch (Lesebefehl! Echt jetzt!) am letzten Wochenende aus meinem Bücherschrank nahm und begonnen hat, es mit Genuss zu lesen. Er trägt ja auch eine ähnliche Frisur wie der Herr Lobo, wenn auch aus anderen Gründen.
Aber es ist wohl kein Zufall, dass Secundus, noch 16 Jahre alt, sich Marcuses aus meiner Sicht wichtigstes Buch Der eindimensionale Mensch (Lesebefehl! Echt jetzt!) am letzten Wochenende aus meinem Bücherschrank nahm und begonnen hat, es mit Genuss zu lesen. Er trägt ja auch eine ähnliche Frisur wie der Herr Lobo, wenn auch aus anderen Gründen.Marcuse war schon in der Generation meiner Eltern einer der wichtigsten Denker und Argumentierer des Widerstandes. Und ein brillanter Analytiker von Gewalt (die nach seiner Definition immer nur aus einer Machtposition heraus ausgeübt werden kann, weil das, was andere Gewalt nennen oder Terror, wenn er nicht aus der Führungsmacht der Elite heraus kommt, eben keine Gewalt sei sondern Widerstand) und der Macht in den Strukturen und Technologien. Was ja auch der Punkt ist, den Sascha anspricht und von ihm aufgreift.
Manchmal wünsche ich mir, dass die Diskussion über die Sicherheitsesoteriker und Kontrollfanatiker mit mehr historischen Kenntnissen geführt würde. Eine Lektüre von Standages Buch (kommt wohl dieses Jahr noch auf deutsch raus) und das Ansehen von Lobos Rede kann dazu der erste Schritt sein. Und wer richtige Lektüre ertragen und verstehen kann, sollte dringend Marcuse lesen.
Und dann reden wir weiter, ok?
Update 8.5.:
In dem Sinne: Weitermachen
(Hinweis auf das Bild fand ich bei André Vatter, der es anders sieht als ich)
5.5.14
Hausgeburten und Krankenhäuser
Internationaler Hebammentag. Zeit, an unsere vielen Hebammen zu denken, die wir bei vier Geburten kennen lernten (mal abgesehen von denen in der Verwandtschaft oder Verschwägerschaft). Und so ziemlich jede Möglichkeit, wie Hebammen - noch - arbeiten können in diesem Land, bis sie faktisch abgeschafft werden, haben wir dabei kennen gelernt.
Primus und Secundus hat die Liebste im Krankenhaus geboren. Wir haben, wie alle Erstgebärenden, die Tour gemacht und uns dann für das damals ein bisschen marode Marienkrankenhaus entschieden mit dem alten Kreißsaal, weil uns die gekachelten Einzelzellen nicht geheuer waren. Und wir nicht so wirklich gerne allein sein wollten. Vorbereitungskurs und Nachsorge haben jeweils Hebammen aus dem Stadtteil gemacht, bei der Geburt waren die Krankenhaushebammen dabei (und einmal leider der Oberarzt, weil die Liebste als Beamtin privat versichert ist, aber das ist noch mal eine andere Geschichte).
Vor allem die Nachsorge war uns bei den ersten Kindern wichtig. Die Hebamme gab uns Sicherheit und hat uns alle Handgriffe gezeigt und uns bestärkt, dass wir es können. Wir waren ja noch jung und die ersten in unserem Umfeld, die Kinder bekamen.
Bei Tertius war uns klar, dass wir nicht wieder ins Krankenhaus wollen. Zum einen, weil eine Geburt keine Krankheit ist. Und zum anderen, weil wir ein unschönes Erlebnis mit Krankenhäusern hatten, das hier nichts zur Sache tut. Geburtshäuser waren recht in damals. Und dann kam die Liebste irgendwann auf den Gedanken, dass dann ja auch eine Hausgeburt denkbar wäre. Denn was wäre schließlich der Vorteil eines Geburtshauses gegenüber einer Hausgeburt? Wenn es hart auf hart kommt, muss eh ein Weg ins Krankenhaus sein. Das von unserem Haus nicht so weit entfernt war.
Im Nachhinein kommt mir eigentlich am merkwürdigsten vor, dass eine Hausgeburt so gar nicht auf unserem Radar war. Dass wir noch nie von einer gehört hatten (außer bei den Alten, klar). Wir haben dann recherchiert. Und die großartige Hebammenpraxis in Norderstedt gefunden, was damals sehr nah bei uns war, als wir noch in Duvenstedt wohnten. Und in der es tatsächlich Hebammen gab, die Hausgeburten machten. Martina, unsere Hebamme, hat uns durch die Schwangerschaft begleitet und uns bei der Geburt beigestanden. Secundus, damals noch nicht fünf Jahre alt, hat mit ihr zusammen die Nachgeburt untersucht. Die Hausgeburt war, wenn man das (und dann als Mann) von einer Geburt sagen darf, wunderschön. Im eigenen Haus, im eigenen Bett, ohne Fahrt durch die Nacht. Ohne Hektik und Umzug vom Kreißsaal in ein Krankenbett. Mit der U1 direkt bei uns. Die beiden Großen hätten zu unseren Nachbarn gehen können, wachten aber erst auf, als Tertius schon da war. Wir haben es uns dann zusammen gemütlich gemacht.
Als Quarta unterwegs war, gab es für uns keine Frage, wo die Liebste sie gebären wird. Sie kam auch zu Hause zur Welt. Beide kleinen Kinder waren sehr groß. Wir waren gemeinsam schon etwas älter, sogar so alt, dass wir massiv gedrängt wurden (nicht von der Hebamme), die abtreibungsvorbereitende Fruchtwasseruntersuchung machen zu lassen. Die Geburt war ein sehr hartes Stück Arbeit. Und dennoch möchten wir uns nicht ausmalen, wie sie - inklusive Schichtwechsel des medizinischen Personals - in einem Krankenhaus verlaufen wäre. Die Ruhe und Gelassenheit von Martina und ihre Erfahrung und Stärke haben uns durch diese vielen Stunden gebracht. Ihre Tipps und Befehle haben die Liebste wieder auf die Beine gebracht im Laufe der dann folgenden Tage. Quartas Weg in das Leben war so ein schöner. Und ich habe heute noch im Ohr, wie Tertius in die Haustür stürmte, als seine Großeltern ihn brachten, kurz nachdem Quarta endlich da war, und krähte: "Wo ist meine kleine Schwester?". Das gemeinsame Kuscheln mit denen, die es wollen, war wie auch bei seiner Geburt das wunderbarste an der Hausgeburt. Die Ruhe, die Möglichkeit, unter uns zu sein, keinen Besuch zu haben, nicht aufstehen zu müssen, ganz auf die Beziehung und das Kennenlernen des neuen Menschen konzentriert zu sein.
Geburten in Krankenhäusern sind nicht schlecht. Und ich kann nachvollziehen, wieso es für viele Mütter der normale Weg ist, ihr Kind zu gebären. Aber nachdem wir alles erlebt haben - von einer sehr langen, super anstrengenden Geburt im Krankenhaus über eine sehr leichte und schnelle eben dort und eine leichte und schnelle zu Hause bis hin zu einer sehr mühsamen zu Hause -, bin ich bestürzt, dass diese Wahl kaum noch möglich sein wird. Schon, dass es - anders als beispielsweise in den Niederlanden - bei uns so exotisch ist, finde ich schwer zu verstehen. Und dass es uns nicht mal in den Sinn kam, wir diese Möglichkeit gar nicht kannten, als wir das erste Mal schwanger waren, irritiert mich noch immer.
Jede Hebamme, die Hausgeburten macht, wird eine Frau nur dann begleiten, wenn alle Untersuchungen dafür sprechen, dass das Kind oder die Frau keine medizinische Versorgung brauchen werden, die nur ein Krankenhaus bieten kann. Und ohne eine Anmeldung in einer Klinik sozusagen als Fallback-Lösung hätte Martina keine Geburt mit uns zu Hause gemacht. Ihre jahrelange Erfahrung und die ihrer Kolleginnen ist größer und reicher als die der meisten Menschen, die einem im Krankenhaus beistehen. Und davon haben wir profitiert.
Ich kann nur ermutigen, eine Hausgeburt zumindest in die Wahl zu nehmen und mit einer erfahrenen Hebamme darüber zu sprechen. Dass es diese Wahl (noch) gibt, ist etwas, das wunderbar ist. Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist nicht alternativlos. Und ich möchte verdammt noch mal, dass das so bleibt. Und hoffe, dass Herr Gröhe, der eigentlich ja für dieses Thema aufgeschlossen ist und weiß, was es bedeutet, tatsächlich noch eine Lösung findet.
Primus und Secundus hat die Liebste im Krankenhaus geboren. Wir haben, wie alle Erstgebärenden, die Tour gemacht und uns dann für das damals ein bisschen marode Marienkrankenhaus entschieden mit dem alten Kreißsaal, weil uns die gekachelten Einzelzellen nicht geheuer waren. Und wir nicht so wirklich gerne allein sein wollten. Vorbereitungskurs und Nachsorge haben jeweils Hebammen aus dem Stadtteil gemacht, bei der Geburt waren die Krankenhaushebammen dabei (und einmal leider der Oberarzt, weil die Liebste als Beamtin privat versichert ist, aber das ist noch mal eine andere Geschichte).
Vor allem die Nachsorge war uns bei den ersten Kindern wichtig. Die Hebamme gab uns Sicherheit und hat uns alle Handgriffe gezeigt und uns bestärkt, dass wir es können. Wir waren ja noch jung und die ersten in unserem Umfeld, die Kinder bekamen.
Bei Tertius war uns klar, dass wir nicht wieder ins Krankenhaus wollen. Zum einen, weil eine Geburt keine Krankheit ist. Und zum anderen, weil wir ein unschönes Erlebnis mit Krankenhäusern hatten, das hier nichts zur Sache tut. Geburtshäuser waren recht in damals. Und dann kam die Liebste irgendwann auf den Gedanken, dass dann ja auch eine Hausgeburt denkbar wäre. Denn was wäre schließlich der Vorteil eines Geburtshauses gegenüber einer Hausgeburt? Wenn es hart auf hart kommt, muss eh ein Weg ins Krankenhaus sein. Das von unserem Haus nicht so weit entfernt war.
Im Nachhinein kommt mir eigentlich am merkwürdigsten vor, dass eine Hausgeburt so gar nicht auf unserem Radar war. Dass wir noch nie von einer gehört hatten (außer bei den Alten, klar). Wir haben dann recherchiert. Und die großartige Hebammenpraxis in Norderstedt gefunden, was damals sehr nah bei uns war, als wir noch in Duvenstedt wohnten. Und in der es tatsächlich Hebammen gab, die Hausgeburten machten. Martina, unsere Hebamme, hat uns durch die Schwangerschaft begleitet und uns bei der Geburt beigestanden. Secundus, damals noch nicht fünf Jahre alt, hat mit ihr zusammen die Nachgeburt untersucht. Die Hausgeburt war, wenn man das (und dann als Mann) von einer Geburt sagen darf, wunderschön. Im eigenen Haus, im eigenen Bett, ohne Fahrt durch die Nacht. Ohne Hektik und Umzug vom Kreißsaal in ein Krankenbett. Mit der U1 direkt bei uns. Die beiden Großen hätten zu unseren Nachbarn gehen können, wachten aber erst auf, als Tertius schon da war. Wir haben es uns dann zusammen gemütlich gemacht.
Als Quarta unterwegs war, gab es für uns keine Frage, wo die Liebste sie gebären wird. Sie kam auch zu Hause zur Welt. Beide kleinen Kinder waren sehr groß. Wir waren gemeinsam schon etwas älter, sogar so alt, dass wir massiv gedrängt wurden (nicht von der Hebamme), die abtreibungsvorbereitende Fruchtwasseruntersuchung machen zu lassen. Die Geburt war ein sehr hartes Stück Arbeit. Und dennoch möchten wir uns nicht ausmalen, wie sie - inklusive Schichtwechsel des medizinischen Personals - in einem Krankenhaus verlaufen wäre. Die Ruhe und Gelassenheit von Martina und ihre Erfahrung und Stärke haben uns durch diese vielen Stunden gebracht. Ihre Tipps und Befehle haben die Liebste wieder auf die Beine gebracht im Laufe der dann folgenden Tage. Quartas Weg in das Leben war so ein schöner. Und ich habe heute noch im Ohr, wie Tertius in die Haustür stürmte, als seine Großeltern ihn brachten, kurz nachdem Quarta endlich da war, und krähte: "Wo ist meine kleine Schwester?". Das gemeinsame Kuscheln mit denen, die es wollen, war wie auch bei seiner Geburt das wunderbarste an der Hausgeburt. Die Ruhe, die Möglichkeit, unter uns zu sein, keinen Besuch zu haben, nicht aufstehen zu müssen, ganz auf die Beziehung und das Kennenlernen des neuen Menschen konzentriert zu sein.
Geburten in Krankenhäusern sind nicht schlecht. Und ich kann nachvollziehen, wieso es für viele Mütter der normale Weg ist, ihr Kind zu gebären. Aber nachdem wir alles erlebt haben - von einer sehr langen, super anstrengenden Geburt im Krankenhaus über eine sehr leichte und schnelle eben dort und eine leichte und schnelle zu Hause bis hin zu einer sehr mühsamen zu Hause -, bin ich bestürzt, dass diese Wahl kaum noch möglich sein wird. Schon, dass es - anders als beispielsweise in den Niederlanden - bei uns so exotisch ist, finde ich schwer zu verstehen. Und dass es uns nicht mal in den Sinn kam, wir diese Möglichkeit gar nicht kannten, als wir das erste Mal schwanger waren, irritiert mich noch immer.
Jede Hebamme, die Hausgeburten macht, wird eine Frau nur dann begleiten, wenn alle Untersuchungen dafür sprechen, dass das Kind oder die Frau keine medizinische Versorgung brauchen werden, die nur ein Krankenhaus bieten kann. Und ohne eine Anmeldung in einer Klinik sozusagen als Fallback-Lösung hätte Martina keine Geburt mit uns zu Hause gemacht. Ihre jahrelange Erfahrung und die ihrer Kolleginnen ist größer und reicher als die der meisten Menschen, die einem im Krankenhaus beistehen. Und davon haben wir profitiert.
Ich kann nur ermutigen, eine Hausgeburt zumindest in die Wahl zu nehmen und mit einer erfahrenen Hebamme darüber zu sprechen. Dass es diese Wahl (noch) gibt, ist etwas, das wunderbar ist. Ein Aufenthalt im Krankenhaus ist nicht alternativlos. Und ich möchte verdammt noch mal, dass das so bleibt. Und hoffe, dass Herr Gröhe, der eigentlich ja für dieses Thema aufgeschlossen ist und weiß, was es bedeutet, tatsächlich noch eine Lösung findet.
Abonnieren
Posts (Atom)