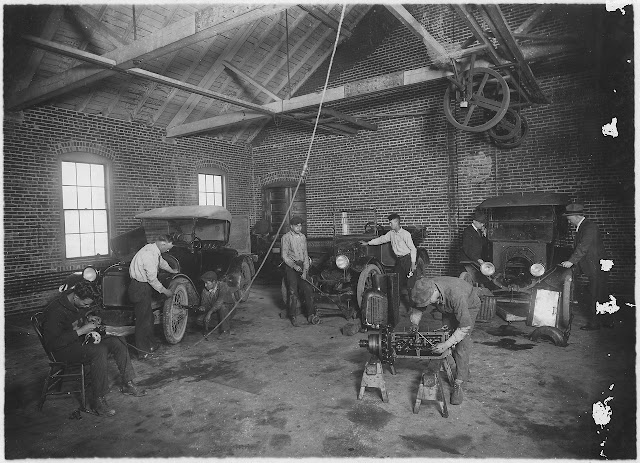Dramatik, Tiere, Kinder, Wildnis, ein Happy End. Alles, was eine gute Geschichte braucht. Passiert im Sommer 2014 im Kattegat. Die Geschichte zur Abschlussgala der Social Media Week Hamburg heute Abend: #140Geschichte – und der Abend selbst ist ja auch mitgeschnitten worden, unten ist das Video eingebunden...
Ein Tweet und seine Geschichte
Wir waren im Heidegebiet zwischen Dünen und Wald mit den Kindern und dem Hund wandern. Oder spazieren gehen wohl eher. Schönes Wetter, hin und wieder war das Meer zu sehen. Wir spielten mit dem Hund, der vor uns her auf dem Pfad durch die Heide und die dichter werdenden Büsche lief.
 |
| Monty geht mit uns spazieren |
Wir haben einen tollen Hund. Ein kleiner Mini Australian Shepherd, gerade für einen Rüden wirklich sehr klein. Er bleibt bei uns, weil er ein Hütehund ist – und weil er auch ein bisschen ängstlich ist, ehrlich gesagt...
Als wir um eine Ecke bogen, lief er etwas vor uns her und steckte seine Nase ins Unterholz, als er irre laut aufjaulte und einen Riesensatz nach hinten sprang. Er klemmte den Schwanz ein und versteckte sich zitternd hinter uns. Zwar ist er ängstlich, aber so was hatten wir wirklich noch nie erlebt.
Was dann passierte, veränderte unser Leben
Wir dachten an einen spitzen Stein oder so was. Ich ging ein paar Schritte vor und guckte auf die Stelle, von der er weggesprungen war. Und hörte nicht nur ein (wenn man es aus heutiger Sicht betrachtet wirklich unerhört) lautes Zischen. Sondern sah auch eine sich hoch aufrichtenden Schlange. So was hatte ich noch nie gesehen, die liegen sonst immer träge in der Sonne, wenn man sie mal zu sehen bekommt. Diese hatte den Kopf erhoben, das Maul leicht geöffnet, die Zunge rausgestreckt. Sehr aufgeregt.
 |
| unsere Kreuzotter |
Die Frau wusste sofort was es war (ich übrigens nicht, denn ich kenne mich mit so was nicht aus). Vorsichtshalber machte ich ein Foto, weil ich ihr nicht glaubte. Und später, als wir wieder richtiges Internet hatten, kontrollierte ich, misstrauisch wie ich bin, auf Wikipedia, ob es stimmt. Was es selbstverständlich tat, was mir auch klar war, irgendwie.
Ja, es war eine Kreuzotter. Und das einzige, was wir sicher wussten, war, dass die echt giftig sind. Wie giftig, wussten wir nicht. Klein war sie ja, diese Kreuzotter. Unser Hund allerdings auch.
Was wir empfanden, alle vier – Tertius und Quarta waren dabei, die beiden großen Kinder waren nicht mitgekommen in diesen Ferien – war schlicht und einfach Panik. Zumal wir weit weg vom Parkplatz waren, wo unser Auto stand. Was auf Læsø, der Insel im Kattegat, auf der wir Urlaub machten, auch hieß, dass wir quasi keinen Telefon- und quasi keinen Internetempfang hatten. Zum Googlen reichte es nicht jedenfalls. Und während die Frau versuchte, unseren Tierarzt daheim anzurufen (wo gerade Mittagspause war), kam ich auf die Idee, auszuprobieren, ob zumindest Tweets durchgehen, wenn schon keine Websites aufgerufen werden können und sich WhatsApp nicht verband. Und er ging durch:
Damals nutzte ich noch Facebook, so dass ich dieses #fb einfügte, damit es auch auf Facebook erscheint. Aber die Antworten kamen auf Twitter. Und die Hilfe auch.
Klar gab es die üblichen Schlauberger, die mir vorwarfen, zu twittern anstatt zu helfen oder einen Tierarzt zu rufen (für wie blöd hielten die mich eigentlich?). Die anderen aber sagten es weiter und Menschen, die ich kannte, ebenso wie Menschen, die ich nicht kannte, antworteten und recherchierten und – sogar das, und das rührte mich besonders – riefen ihre Tierärztin an, um sich zu erkundigen.
Und viele dieser Antworten kamen auch durch zu mir, in Schwüngen, wie das so ist mit zwei Balken wackeligem Edge. Die Frau erreichte Primus, der es weiter in unserer Tierarztpraxis versuchte. Und erreichte ihre Schwägerin, die auf dem Land lebt und ihre Landtierärztin zu erreichen versuchte. Primus verfolgte die Antworten auf Twitter, um auf dem Laufenden zu sein – und um Ideen und Hinweise an unseren Tierarzt weiterzugeben, der noch nie einen Kreuzotterbiss hatte.
Was wir durch die vielen Menschen, die sich mit wirklichen Tipps äußerten, schnell raushatten, war, was wir als erstes tun müssen: den Hund tragen, damit er sich nicht anstrengt. Denn, auch das bekamen wir recht schnell raus, für einen so kleinen Hund ist eine Kreuzotter tatsächlich lebensgefährlich. Es ist faszinierend, was wir so nach und nach über Kreuzottern lernten in diesem Zusammenhang. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das zweite war: Zu versuchen, das Gift aus der Nase des Hundes, in der der Biss der Otter war, zu saugen. An einer Hundenase zu saugen, ist nun alles andere als vergnügungssteuerpflichtig. Aber ich fand es notwendig. Und das im Laufen, denn wir wollten schnell zum Auto, vielleicht hätte wenigstens die Menschenpraxis noch auf, wo es schon keine Tierärztin auf der Insel gibt.
Was wir unter anderem lernten durch die Menschen, die an besserem Internet saßen, während wir durch die Heide eilten: Dass Kreuzottern meistens gar kein Gift spritzen, wenn sie beißen. Weil sie dann tendenziell verhungern, wenn kein Gift mehr für ihr Essen da ist. Und dass der Hund innerhalb kurzer Zeit apathisch würde, wenn er vergiftet wäre. Wodurch wir zwischen Hoffen und Bangen schwebten, während wir – wie gesagt – durch die Heide eilten.
Auf dem Parkplatz trafen wir ein Paar mit zwei Hunden, das gut deutsch sprach. Er Luxemburger, die aus Læsø, die den Sommer wie immer auf der Insel verbrachten. Und die, weil sie ja alle hier kennen, versuchten, den pensionierten Tierarzt zu erreichen (der nur dänisch spricht). Dem Hund ging es nicht schlechter. Er war nur immer noch sehr verängstigt, was durch das Tragen und Laufen auch nicht besser geworden war.
Das Paar war mit Freunden auf der Insel von denen einer ein Arzt war. Die einzige Praxis der Insel, auf die wir unsere Hoffnung gerichtet hatten, war für heute, wie wir von ihnen erfuhren, selbstverständlich schon geschlossen. Und der diensthabende Arzt wahrscheinlich aufs Festland rüber gefahren. Wir fuhren gemeinsam zu ihrem Haus, unten in Vesterø, am Meer. Der Arzt hatte schon recherchiert und die von unserer allerdings auch unerfahrenen Tierärztin empfohlene Kortison-Therapie als veraltet entlarvt. Stattdessen bekam unser Hund ein Antihistamin. Und ihm ging es zum Glück auch immer noch nicht schlechter.
Am Ende hatten wir Glück. Sehr viel Glück. Der kleine Hund war offenbar für die Kreuzotter nicht so bedrohlich, dass sie ihm das Gift spritzte. Wir sind alle zusammen mit dem Schrecken davon gekommen. Vor allem aber habe ich wieder einmal festgestellt:
Und hier die gesamte Gala, meine Geschichte kommt fast am Ende: