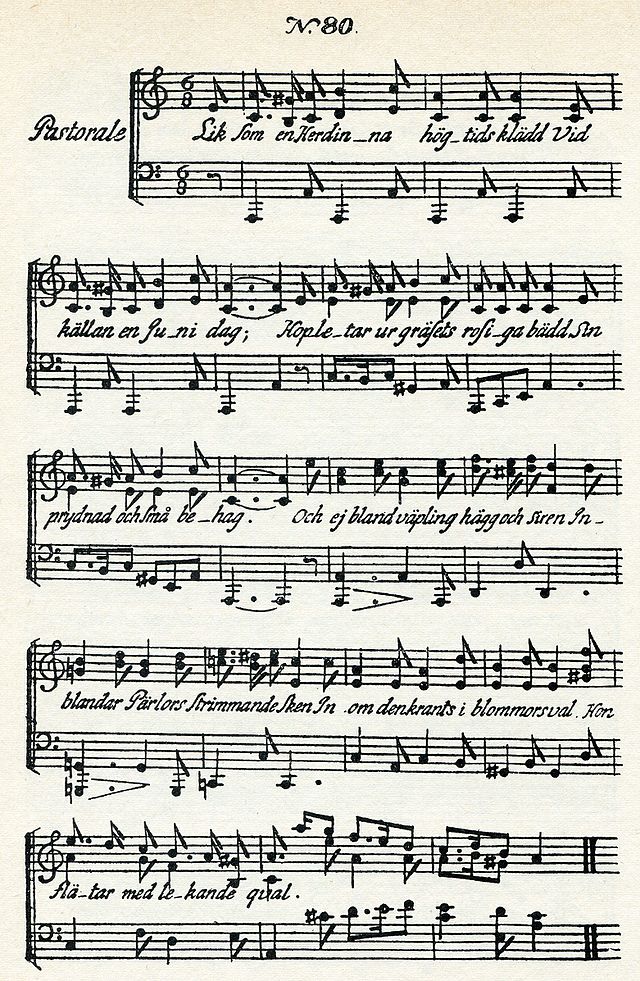Der eine oder die andere weiß ja, dass ich ein begeisterter Reiter bin. Noch nicht so ewig, denn wie die meisten reitenden Männer, die ich kenne, war ich am Anfang Mit-Reiter meiner Frau und Turniertrottel für eines meiner Kinder. Vor rund 25 Jahren saß ich dann also erstmals auf einem Pferd, fein durch die Lüneburger Heide juckelnd. Und als wir vor fast genau sieben Jahren wieder anfingen, war ich dann auch recht bald wieder dabei, seit ziemlich genau einem Jahr habe ich mein eigenes Pferd, mein
Riesenteddypferdchen, hier kuschelnd mit meinem Sohn:

Was ich über die Jahre beim Reiten gelernt habe (abgesehen von der Binsenweisheit, die sicher viele Eltern von reitenden Jugendlichen bestätigen können, dass Kinder, die reiten, oft etwas leichter oder besser oder ausgeglichener oder so durch die Pubertät kommen), ist vor allem eine schöne Kombination aus Demut und Führungsstärke. Eine Kombination also, die ohnehin sehr hilfreich ist und gut tut und zur Grundausstattung von Führungskräften dazu gehören sollte, wenn es gut läuft.
Das Faszinierende an der Freizeit (oder dem Arbeiten, je nach Belieben) mit Pferden ist ja, dass dieses Tier einerseits so sehr viel größer und gewaltiger und schwerer und kräftiger ist als ich. Selbst für unsere kleinen, netten Islandpferde gilt dies ja, noch viel mehr für die großen, die dazu auch oft noch schreckhafter sind. Und dass es andererseits so bereitwillig nach Führung und Anlehnung sucht und diese auch dankbar annimmt, wenn nicht irgendwas irgendwann einmal komplett falsch gelaufen ist mit dem Tier.
Ich bin beileibe kein guter Reiter. Aber mit ein bisschen Übung schaffe sogar ich, dass ein Pferd mir zuhört und macht, was ich will. Wenn ich es weiß. Also, was ich will. Denn genau das ist das Geheimnis. Und genau das ist es, was Reiten so sehr mit Führung gemeinsam hat.
Etwas holzschnittartig gesagt, braucht das Pferd klare Ansagen von mir. Keine groben, nicht mit Gewalt oder Kraft - aber klare Ansagen und die Sicherheit, dass ich es schon richtig machen werde. Wie sonst sollte es rückwärts gehen, obwohl es weiß, dass da irgendwann ein Zaun kommt. Wie sonst sollte es in einen Bach gehen, obwohl es nicht weiß, was da unter der Wasseroberfläche lauert.
Was mich immer wieder mit Erstaunen erfüllt, ist das große Bedürfnis meines Pferdes, es richtig zu machen, mir zu gefallen in gewisser Weise. Darauf einzugehen, was ich von ihm will, wenn es denn versteht, was ich will. Und genau das ist es, was ich erstmal lernen musste: Wie ich nicht nur weiß, was ich will - sondern auch noch ausdrücken kann, was ich will, auf eine Weise, die mein Pferd versteht. Denn der wunderbare Satz, dass man beim Reiten lernen müsse, nicht mit dem Kopf sondern mit dem Arsch zu denken, stimmt ja einfach.
Pferde sind gutmütige Tiere. Aber sie sind Fluchttiere. Ihr "natürlicher" Instinkt ist es, wegzulaufen, wenn etwas merkwürdig ist. Darum brauchen sie so viel Sicherheit, darum sprechen meine Reittrainerinnen von "Anlehnung", von der Kombination aus "Versammlung" und "Losgelassenheit", wenn sie beschreiben, was ich für mein Pferd erreichen soll. Und die Parallele zur Führung eines Teams, eines Unternehmens und so weiter schenke ich mir einfach, sie ist allzu offensichtlich.
Wenn ich dem Tier Sicherheit gebe und es mir vertraut, dass ich es nicht in die Irre führe, wenn ich vermittele, zu jedem Zeitpunkt gelassen zu wissen, wo es hin geht - dann wird es fast immer machen, was ich will. Wenn ich unsicher bin, wird es auch unsicher, verspannt sich, macht Fehler.
Zu lernen, dieses große, großartige, sensible, ängstliche Tier zu führen, ist für mich sehr beglückend gewesen. Dass ich mit Hintern und Schenkeln helfen kann und die Zügel nur noch brauche, weil ich die Hände ja irgendwo lassen muss. Mich zugleich auszuliefern (denn hey, wenn es will, kann mein Pferd immer noch machen, was es will, ich habe faktisch keine Chance gegen es, wenn es drauf ankommt) und zu wissen, dass ich mich nicht ausliefere. Gegenseitig zu vertrauen, obwohl Vertrauen in ein Tier an sich absurd ist. In einer Extremsituation, wenn das Pferd durchgeht, zu realisieren, dass nur eine paradoxe Intervention hilft, die Situation zu meistern (hier: treiben und es dazu zu bringen, dass es eher noch schneller wird, anstatt an den Zügeln zu reißen und Gegendruck aufzubauen).
Nicht alles das kann ich wirklich oder gar immer. Und die Angst da oben ist mir durchaus und immer noch vertraut. Wie bewundere ich dann meinen Sohn und seine Freundinnen, die auf ihren Pferden groß geworden sind und machen können, was sie wollen - draufspringen, turnen, tanzen, ohne Sattel und Zügel galoppieren. Denen ihre Tiere so vertrauen, weil sie genau von einander wissen, was sie machen, wollen und können.
Aber ich denke - und damit komme ich am Ende doch noch ein einziges Mal auf das Thema Führung zurück -, dass Reiten eine gute Übung für Menschen ist, die führen wollen oder müssen. Und dass Menschen, denen Führung leicht fällt oder die es zumindest können, wohl auch Reiten lernen können. Meine Vermutung wäre sogar, dass ich an der Art, wie sie sich beim ersten Kontakt mit Pferden "anstellen", zu einem guten Teil sehen kann, wie sie führen im "richtigen Leben". Und dass Übungen auf und mit Pferden für das Lernen von Führung mehr bringen als viele andere Kurse, die gerade modern sind.
Vielleicht sollte ich wirklich mal Managementkurse anbieten. Auf und mit Pferden.