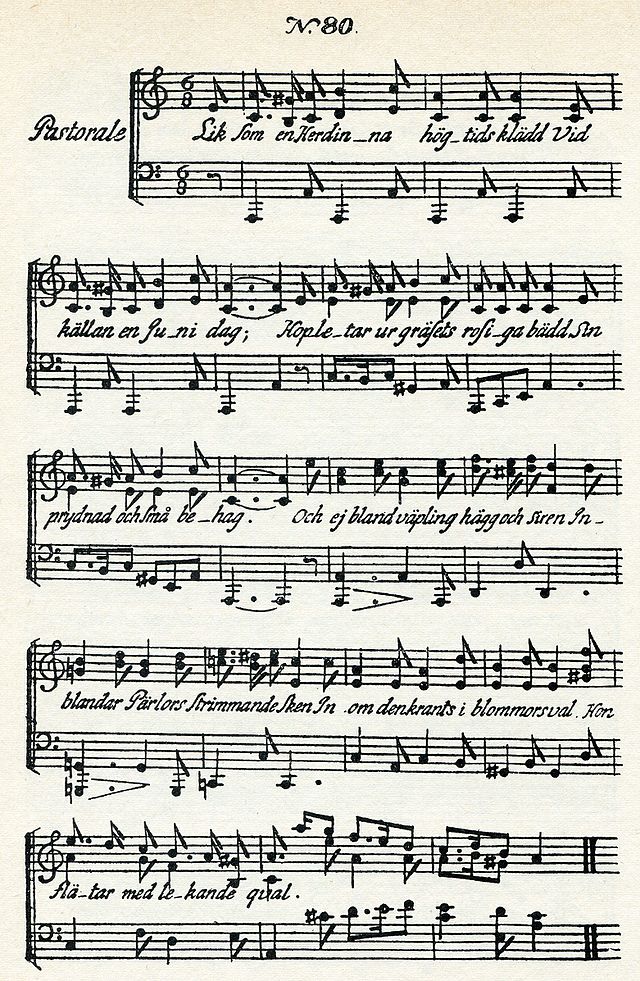In den vergangenen Wochen habe ich mit vielen Menschen über die Erfahrungen der letzten Monate gesprochen und darüber, was wir daraus gelernt haben. Was gut ging, was nicht so gut ging. Was erfolgreich war – und woran wir jeweils gescheitert sind. Die Gespräche waren mit sehr unterschiedlichen Menschen: Coaches, Geschäftsführerinnen andere Agenturen, Geschäftsführerinnen von "Bürounternehmen" und solchen von Unternehmen mit Werkstätten, Redakteurinnen, Freelancerinnen, Lehrerinnen. Nur mal beispielsweise. Die meisten waren in Europa, einige in Nordamerika, wenige in Asien. Zugleich habe ich über meinen Ansatz für Führung ("Freiheitsdressur"/Führen und Folgen in Freiheit) nachgedacht und ob und wie er sich in der Pandemie verändert hat. Gerade auch, weil bei mir ja ein beruflicher Wechsel anstand von der geschäftsführenden Gesamtverantwortung in eine internationale Führungsrolle, die eher über Vorbild als über Macht funktioniert. Und dann las ich den Text des von mir sehr geschätzten Thomas Knüwer, der weissagt, dass der Run aufs Home Office als "Nächstes Normal" der nächste modische Managementfehler sei. Vorab: Ich stimme ihm überwiegend nicht zu. Jedenfalls nicht so.
Wie viele andere habe ich zusammen mit meinem Führungsteam im März entschieden, dass die gesamte Firma ins "Remote Working" geht, wir waren eher früh dran und haben auch keinen Probelauf gemacht. Und wie sehr viele andere haben wir festgestellt, dass das Arbeiten funktioniert. Es entstand eine Art Anfangseuphorie mit sehr vielen Experimenten, wie wir, wie die "Tischgemeinschaften" in der neuen, zerstreuten Situation ihr gewohntes Umfeld nachbauen können. Die ersten Wochen habe auch ich fast ununterbrochen in Videogesprächen verbracht. Irgendwann kam dann die neue Idee, Telefongespräche zu führen und mich dabei zu bewegen, dazu.
Mir geht es bei diesem Text allerdings nicht um die eigenen Erfahrungen – sondern um die Frage, die ich mit vielen gerade diskutiere und die auch Thomas anspricht: Ist das, was wir aus guten Gründen und mit viel Phantasie und Anstrengung für die Pandemie geschaffen haben, ein Zukunftsmodell? Wird Arbeiten, zumindest für uns Büro-/Computer-/Telefon-/Meetings-Arbeitende so auf Dauer sein? Was macht das mit uns, mit unserer Art, wie wir miteinander umgehen? Was macht das mit Führung?
 |
| Kasa Fue / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |
Denn ich beobachte mit einer gewissen Faszination, wie unterschiedlich in den letzten Wochen die langsame und kontrollierte Öffnung der Büros war. Also nicht die Konzepte, die waren fast überall sehr ähnlich. Sondern wie unterschiedlich und auf den ersten Blick zufällig die Reaktion der Mitarbeitenden darauf war. Einige Kolleginnen erzählen, dass quasi niemand zurück gekommen ist. Auf einer Fläche, wo vorher dreißig bis achtzig Leute arbeiteten, sind jetzt meistens zwei oder drei (obwohl inzwischen bis zu 50% da sein dürften). Andere berichten, dass sie Schichtdienste einführen mussten, weil fast alle das Bedürfnis hatten, zurück zu kommen. Und wieder andere, dass es in der gleichen Firma von Stadt zu Stadt, von Büro zu Büro unterschiedlich sei. Das einzige Muster, das zu erkennen ist, hängt mit der Wohn- und Lebenssituation zusammen. Und teilweise mit dem Alter, wobei das ja oft zusammenhängt. Mein Eindruck ist allerdings – anders als Thomas vermutet –, dass es nicht etwa die Millenials sind, die als erstes zurück wollten, sondern oft die Jüngeren und die etwas Älteren. Aber das ist eher anekdotisch als gemessen.
Es gibt ein paar Dinge, die ich erstaunlich finde und die ungewöhnlich unproblematisch sind aus meiner Sicht. Zum Einen sind auch lange und intensive Meetings – sei es für Managemententscheidungen oder für die Entwicklung von Ideen und Programmen – in verteiltem Arbeiten problemlos möglich. Gerade die, die sonst eher stiller sind und Meetings nicht so stark dominieren, kommen, so habe ich den Eindruck, besser zu Wort und haben einen größeren Anteil. Zum Anderen berichten mir viele (und ist es auch meine Erfahrung), dass die Integration von Neuen und das Einarbeiten und Ins-Team-Finden zwar anders aber nicht schlechter oder schwieriger ist. Und zum Dritten ist der Informationsfluss eher größer als kleiner, weil eben doch recht viel schriftlich passiert oder aufgezeichnet wird (bei großen Videokonferenzen), also sehr viel asynchronerer Austausch passiert, was logischerweise besser ist, wenn das Ziel ist, dass möglichst viele möglichst viel wissen.
Aber ich sehe auch vor allem zwei Dinge, die wir lösen müssen, wenn es in das "Nächste Normal" geht - und die sich nicht einfach durch "Nachbauen" dessen, was wir vorher kannten, erreichen lassen:
Anreize, zusammen zu kommen
Noch geht es darum, den "Sog" in die Büros zu verhindern. Also bis zum vorläufigen Ende der Pandemie (oder bis zu einer Situation, die wir zum nächsten Normal erklären) Wege zu finden, die es aus Sicht der Mitarbeitenden nicht "nötig" machen, regelmäßig im Büro zu sein. Das läuft ganz gut an.
Aber was machen wir, wenn die Mitarbeitenden nicht mehr kommen wollen? Wenn sie den Eindruck haben, es ginge auch gut so (und sie ja auch Recht haben damit)? Wenn wir aber hin und wieder Orte brauchen, an denen wir uns auch riechen und anfassen und in Bewegung sehen. Ich nehme an, dass wir dazu kommen werden, insbesondere interne Weiterbildung anders zu verstehen und mit Aktivitäten an einem Ort zu verbinden. Im "Büro" zusammen zu kommen (oder wo auch immer), wird, denke ich, anders sein müssen als einfach nur das zu arbeiten, was wir auch gut oder besser woanders machen können. Denn mal ehrlich: für das, was ich überwiegend allein mache, gibt es objektiv keinen Grund, ins Büro zu kommen.
Was ist die nächste Iteration der Luxusverpflegung der großen Tech-Firmen oder des Frühstücks der Agenturen, beides ja eingeführt, damit die Menschen (pünktlich) ins Büro kommen? Ich rechne nicht damit, dass uns zwei Mal im Jahr die große Alle-Hände-an-Deck-Firmen-Versammlung reicht oder die zwei Feste, so es die noch gibt in der angespannten wirtschaftlichen Situation vieler Firmen in der immer länger währenden Pandemie. Wie müssen Büros sein und was muss da passieren, damit Mitarbeitende da hin kommen?
Wo kommen wir zusammen, um uns von anderen Seiten zu erleben als von vorne im Video? Mir geht es nicht um Freundschaften oder Gemeinschaft – die sind für die eine oder andere auch wichtig, aber das zu schaffen oder dafür Räume zu haben, ist meines Erachtens nicht Aufgabe eines Unternehmens. Zu wissen, dass wir in die gleiche Richtung laufen, und uns zu vergewissern, dass die anderen, die da mitlaufen, auch ok sind und uns nichts Böses wollen – das ist allerdings Aufgabe eines Unternehmens. Ich denke, dass eine Grundhaltung hermeneutischen Wohlwollens heute notwendig ist für einen Unternehmenserfolg (oder zumindest für einen längerfristigen Erfolg). Und die ersten Anzeichen sind da, dass ein fast nur virtuell geführtes und arbeitendes Team eher anfälliger für politisches Handeln ist und für (negative) Eigendynamiken in neuen und kaum noch sichtbaren informellen Systemen.
Management by walking around
Das informelle System zu lesen und bespielen zu können, ist nach meiner Erfahrung und Überzeugung eine Schlüsselqualifikation heutiger Führung. Auch wenn sie nicht so radikal verstanden wird, wie ich es tue mit meiner Idee "Freiheitsdressur" (dazu später mal mehr), ist zeitgemäße Führung ohne "walking around" nicht denkbar. Ja, das wird oft belacht. Aber eine Führung, die sensibel für das ist, was an Dynamik im Team oder unter den Menschen, die da arbeiten, passiert, die also das informelle System erkennt, kann sehr viel besser mit Delegation und mit "weichen" Parametern arbeiten als eine, die im Einzelbüro sitzt und sehr beschäftigt ist. Mal etwas holzschnittartig formuliert.
Ich kann zumindest für mich sagen, dass ich bisher keinen Weg gefunden habe, das informelle System unter den Bedingungen des Remote Working in gleicher, sicherer Weise zu lesen. Die Kleinigkeiten wahrzunehmen und daraus ein Bild zu formen. Führung aber ist in den meisten Fällen darauf angewiesen, sich dieses Bild zu formen, weil sie ganz selbstverständlich nicht automatisch in Gespräche einbezogen wird. Platt gesagt: es erzählt einem nun mal niemand was.
Darum denke ich, dass Thomas zwar irrt mit seiner Einschätzung, dass Remote Working, dass Home Office beispielsweise Karrieren in größeren Unternehmen erschwert (anders macht, klar, aber nicht erschwert). Und dass seine relativ pauschale Kritik an der aktuellen Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auch am Kernproblem vorbei geht. Aber: ja, ich stimme da zu, wo er die Einschätzung hat (oder haben sollte), dass dieses Nächste Normal mit mehr Arbeit außerhalb von Büros nicht mit den Führungsmethoden der Zeit vorher zu bewältigen ist. Ich bin nur wahrscheinlich optimistischer, dass wir es schaffen können, vor allem auf die zwei Fragen oben Antworten zu finden. Wenn wir sehen, dass sie offene Fragen sind (und hier bin ich dann wieder bei ihm im latenten Pessimismus, denn dazu müssen wir ja so ehrlich zu uns selbst sein, zu sehen, wo die Fragen offen bleiben und auch was wir gerade nicht können oder wo wir gerade scheitern).
Lernen von Handwerk und Gewerbe
Und darum noch ein anderer Aspekt angerissen, der oft zu kurz kommt. Ja, wir reden hier (und die meisten mit denen ich rede) sehr von Büro-/Computer-/Telefon-/Meeting-Arbeit. Das ist nur ein Teil der Arbeit in diesem Land und überall. Von Lehrerinnen höre ich, wie schwer bei ihnen beispielsweise dieses Remote Working umzusetzen war. In Fabriken und Werkstätten werde ich weiterhin überwiegend zusammen kommen, wenn ich arbeite, im Einzelhandel, im Krankenhaus oder in ärztlichen Praxen.
Aber: es gibt auch schon heute und gab vor der Pandemie viele Bereiche, in denen Remote Working normal war. Und die wir Büro-Leute nicht gesehen haben. Handwerk beispielsweise. Wo die Mitarbeitenden allein oder zu zweit unterwegs sind, oft nicht einmal morgens in die Firma kommen sondern direkt mit dem Werkstattwagen von zu Hause starten und dort auch wieder enden. Mit den gleichen Herausforderungen, die wir auf einmal auch haben. Vertrieb, ebenso (und vielleicht auch ein Grund für die Skandale in Vertriebsorganisationen in den letzten Jahren, wenn sie die Antworten auf die Fragen oben übertrieben). So was aber anzusehen und davon zu lernen, wird sich lohnen. Vielleicht sind einige von diesen Berufen und Unternehmen ja viel weiter als wir dachten.