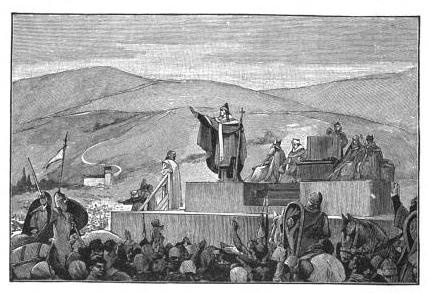Christianismus, der – radikale politische Ideologie, die sich (aus Sicht der meisten Christ:innen: fälschlicherweise) auf das Christentum beruft und vorgibt, eine christliche Gesellschaft formen oder erhalten zu wollen. Die politisch radikale Form eines christlichen Fundamentalismus, oft auch als "religiöse Rechte" oder als "politisches Christentum" bezeichnet.
***
Während über den Islamismus, den "politischen Islam" viel geredet und geschrieben wird und weitgehende Einigkeit besteht, dass Muslim:innen sich vom Islamismus aktiv zu distanzieren haben (auch wenn der in dieser Forderung praktisch inhärente Rassismus noch mal gesondert zu besprechen wäre), ist der Christianismus weitgehend undiskutiert, wenn es nicht um die religiöse Rechte in den USA oder die rechtsradikalen Pflingstgemeinden in Brasilien geht.
Dass aber der Christianismus auch in Europa und speziell in Deutschland ein massives und sehr gefährliches Problem ist, diskutieren wir selten. In Ansätzen erlebe ich die Kritik und die Diskussion langsam in theologisch konservativen evangelischen Kreisen, die sich bewusst und aktiv gegen eine Vereinnahmung durch faschistische Bewegungen und Parteien wehren, aber nicht in der Breite meiner Kirche. Und schon gar nicht in der Politik. Nicht hilfreich (aus religiöser Binnensicht) ist sicher auch, dass ansonsten diese Diskussion eher von einer Gruppe getrieben wird, die ich als "religiöse Atheist:innen" bezeichnen würde, also denen, die Religion – und insbesondere das Christentum – an sich und mit religiösem Eifer ablehnen oder hassen, und den Christianismus darum als "natürliche" Form und logische Konsequenz des Christentums sehen und beschreiben.
***
Und die Versuchung des Christianismus ist für Christ:innen ja auch real – denn wenn ich glaube, dann versuche ich, mein Leben danach auszurichten. Und wenn ich glaube, dass es eine Wahrheit gibt, dann wäre es auch schön, wenn das Leben allgemein auf diese Wahrheit ausgerichtet ist. Wer hier stehen bleibt und daraus ableitet, dass Gesellschaft und Politik so organisiert werden sollen, ja: müssen, überschreitet sehr leicht die Linie, die eine liberale Demokratie von einem autoritären Regime unterscheidet. Und darum sind Christianist:innen so gefährlich, selbst wenn sie (davon gibt es ja bis hin zu Abgeordneten im Bundestag einige) in demokratischen Parteien organisiert sind. Denn in ihrem Inneren können sie nicht akzeptieren, dass die Mehrheit eine andere Entscheidung fällt in Fragen, in denen Christ:innen eine Leitschnur haben. Wer darauf besteht, dass Politik sich an der Wahrheit, an die ich glaube, ausrichtet, kann nicht akzeptieren, wenn sie es nicht tut.
Darum, so denke ich, sind Christianist:innen so anfällig für autoritäre Politikangebote bis hin zu faschistischen Parteien und Bewegungen wie die AfD oder Trump. Weil der Christianismus am Ende nichts mit einer Demokratie anfangen kann. Wer nicht nur für sich selbst keine Grautöne kennt sondern sie auch bei anderen nicht akzeptieren kann, bedroht die Art, wie wir in diesem Land zusammenleben.
***
Den evangelischen Christianismus gibt es in seiner jetzigen Form seit etwa den 1980er Jahren – und er hat sich immer weiter radikalisiert, je mehr sich die Gesellschaft in eine inklusivere, offenere Richtung entwickelte. Am Anfang stand eine Bewegung, die sich gegen die Öffnung der evangelischen Kirchen in Deutschland für nicht-konservative Menschen wendete. Die den Eindruck hatte, dass die evangelischen Kirchen mit ihrer Unterstützung der Ostverträge und mit ihrem Eintreten für eine Friedensethik den Boden von dem verlassen hätten, was sie Bibel und Bekenntnis nannten.
Als jemand, der in den 1980ern sowohl religiös als auch politisch aktiv wurde, erinnere ich mich noch gut, wie die frühen Christianist:innen (eine ihrer damals die Freund:innen meiner Eltern und teilweise auch meine Mutter selbst besonders stark bedrohenden Vertreterinnen bei uns im Norden sitzt heute für die CDU Bremen im Bundestag) in Nordelbien (Hamburg und Schleswig-Holstein) einen Kirchenkampf starteten, den sie mit Spitzeleien führten (beispielsweise indem sie von meinem Propsten jede Predigt mitschrieben und Dienstbeschwerden daraus ableiteten, bis er im Burnout landete). Ein etwas skurril zu lesender Text aus der "Zeit" damals dokumentiert Teile dieser Anfänge ganz gut.
Ich selbst hatte mit der zweiten Generation der Christianist:innen in meiner Kirche immer wieder zu tun, weil ich einige ihrer theologischen Ansätze teilte, vor allem ihre Betonung der lutherischen reformatorischen Tradition. Weshalb ich (als politisch damals Linker) nie bei ihnen mitmachen konnte, war, weil sie schon damals als einzige politische Konsequenz aus einem klaren und entschiedenen Christentum nur einen autoritären Konservatismus akzeptierten. Also schon in den 1990er Jahren aus ihrem radikalen Christ:in-Sein ein eindeutiges politisches Mandat ableiteten. "Left evangelicals", wie es sie in den USA und teilweise in England gibt, gab es damals bei uns nicht, höchstens am Rande in den methodistischen Kirchen.
Meine Beobachtung ist, dass die Christianist:innen sich in dem Maße, in dem sie immer mehr in eine immer kleiner werdende Minderheit gerieten (sowohl kirchlich als auch gesellschaftlich) immer weiter selbst radikalisierten. Im Grunde ähnlich wie die rasante Selbst-Radikalisierung im Zeitraffer, die wir, katalysiert durch Social Media, in den letzten wenigen Jahren auch in vielen anderen Bereichen erleben (bestes Beispiel scheint mir neben einigen Journalisten im Pensionsalter gerade dieser Wirtschaftsprofessor Homburg zu sein, dessen Abgleiten in Verschwörungserzählungen sich quasi live auf Twitter verfolgen lässt bis hin zur Einlassung, seine Kritiker:innen seien von Regierung und Pharmaindustrie bezahlt).
Spätestens seit die sichtbare Galionsfigur des deutschen Christianismus und zugleich ihr (letztes?) Scharnier in den demokratischen Konservatismus, Ulrich Parzany, keine öffentliche Resonanz mehr findet, hat die Selbstviktimierung und damit die Radikalisierung noch einmal an Fahrt aufgenommen. Wie sehr, zeigen die Reaktionen aus dieser inzwischen antidemokratischen Bewegung auf den Rücktritt des sächsischen Bischofs 2019 aufgrund seiner faschistischen Texte um 1990 herum und seiner späteren Auftritte in rechtsextremen Think Tanks.
Ähnlich wie Islamist:innen geraten auch Christianist:innen fast zwangsläufig in eine Situation, in der sie eine offene Gesellschaft und eine liberale Demokratie ablehnen (müssen), weil diese sich nicht an ihrer jeweiligen Wahrheit zu orientieren bereit ist. Auch da, wo sie formal noch in demokratischen Organisationen aktiv sind (Christianist:innen gar nicht so selten in führenden und hauptamtlichen Positionen in der CDU und ihren Arbeitsgemeinschaften), geraten sie immer wieder in Konflikte aufgrund der Tatsache, dass sie eine Toleranz für andere Positionen oder einen anderen Glauben ablehnen. Bei beiden religiösen Deformationen schließt diese Ablehnung auch die jeweilige Mehrheit ihrer Religionen ein.
Christianismus ist darum aus meiner Sicht weit gefährlicher als Islamismus, weil seine Vertreter:innen in der Mitte der Gesellschaft leben und arbeiten, in Medien, in Parteiorganisationen, in Kirchen. Die Beispiele USA, Polen und Brasilien zeigen, dass sie sehr leicht in eine Koalition mit offen faschistischen Führern eintreten, wenn diese ihnen eine Überwindung oder Bekämpfung der offenen Gesellschaft versprechen. Und das passiert vor allem darum, weil sie die Spielregeln der Demokratie für weniger wichtig halten als ihren Glauben, zu dem in seiner extremistischen Variante gehört, dass es falsch und geradezu verbrecherisch ist, ihn nicht zu teilen. Und wenn sie also vor die Wahl gestellt werden, die Demokratie zu verteidigen oder ihren (extremistischen) Glauben, werden sie sich notwendig immer für den Glauben entscheiden.
Sie sind die ersten, die gegen die offene Gesellschaft auch aktiv zu Felde ziehen, wenn es den Hauch einer Chance gibt. Was das irritierende Verhalten auch in Deutschland von Menschen, die sich als christlich identifizieren und dennoch autoritäre und faschistische Parteien wählen, im Zuge der Selbstradikalisierung zumindest erklärt. Was fehlt, ist meines Erachtens eine klare Distanzierung der Kirchen und von (konservativen) Christ:innen von diesen Radikalen.
***
Einmal ganz praktisch: Wo die Grenze zwischen (konservativen) Christ:innen und Christianist:innen verläuft, kann – nur beispielhaft – am Thema Abtreibung gezeigt werden. Gemeinsame Position ist, Abtreibung abzulehnen. Während eine christliche Position, die sich als Teil einer offenen, liberalen Gesellschaft versteht, dann (etwas holzschnittartig) ist, für das werdende Leben zu werben und die eigene Position (werbend) zu erläutern, verlangen Christianist:innen, dass ihre Position auch das staatliche Gesetz ist und können einen anderen Beschluss des Parlaments nicht akzeptieren und wenden psychische Gewalt gegen Menschen an, die ihre Position nicht teilen. Im Zuge ihrer Radikalisierung gehen sie dann manchmal noch weiter, wie wir in Polen und den USA sehen, und wenden auch physische Gewalt an. Hier überschreiten sie die allzu feine Linie vom Extremismus zum Terrorismus, auch das ähnlich wie bei Islamist:innen.
***
Und noch als Ergänzung, weil die eine oder andere gefragt hat: der Christianismus ist meines Erachtens noch mal sehr anders als der (mir ebenfalls unsympathische) Pietismus, vor allem der rheinischer Prägung, der nicht umsonst Pietkong hieß. Aber er war eben auch – so unangenehm er für andere Christ:innen immer war und ist aufgrund seiner Aufdringlichkeit – sehr persönlich und nach innen gerichtet und nicht auf die Welt. Ähnlich wie in den USA, bevor Reagan die rechten Christ:innen politisierte. Insofern halte ich den Christianismus für anders und vor allem extrem viel gefährlicher.